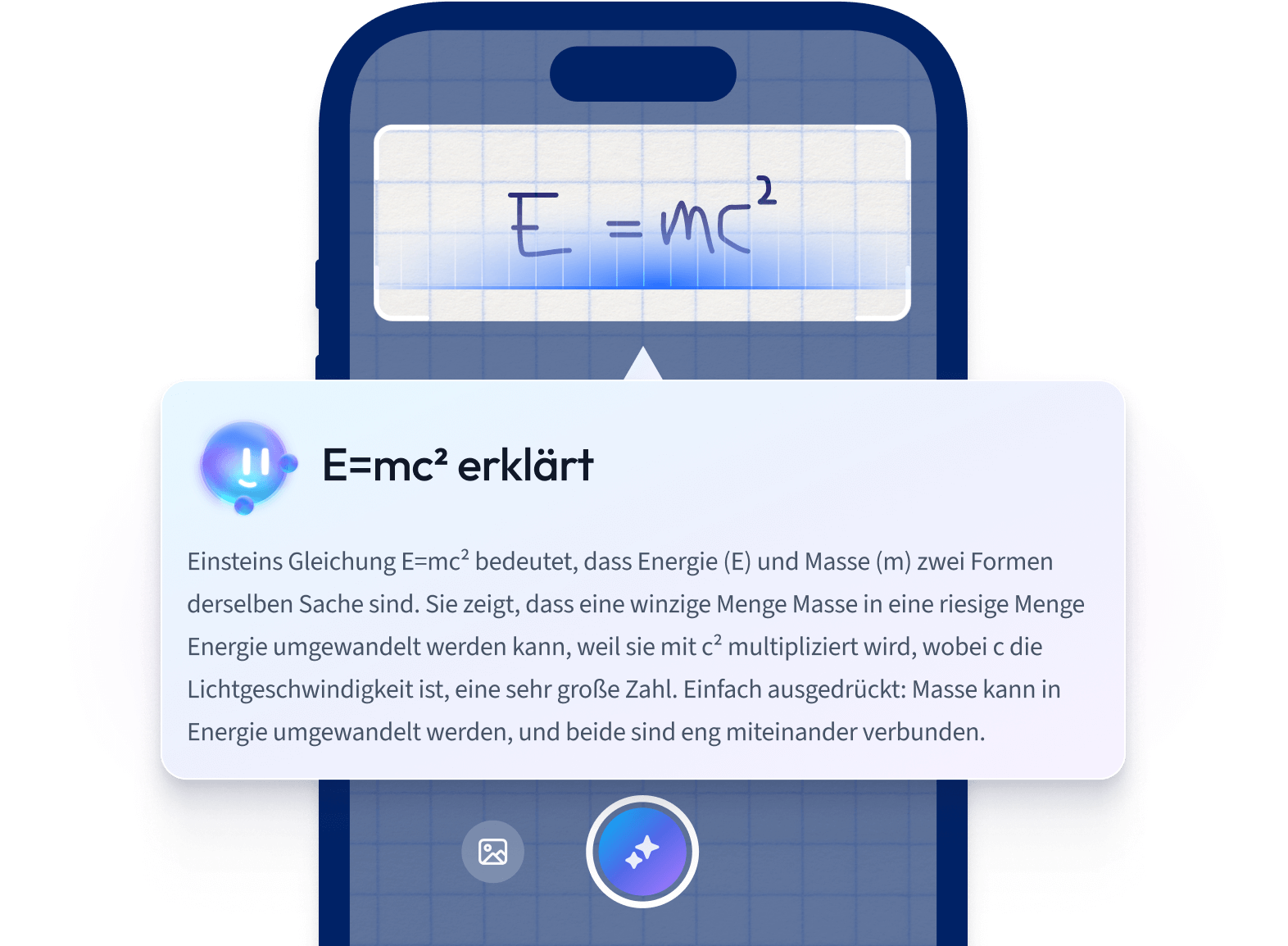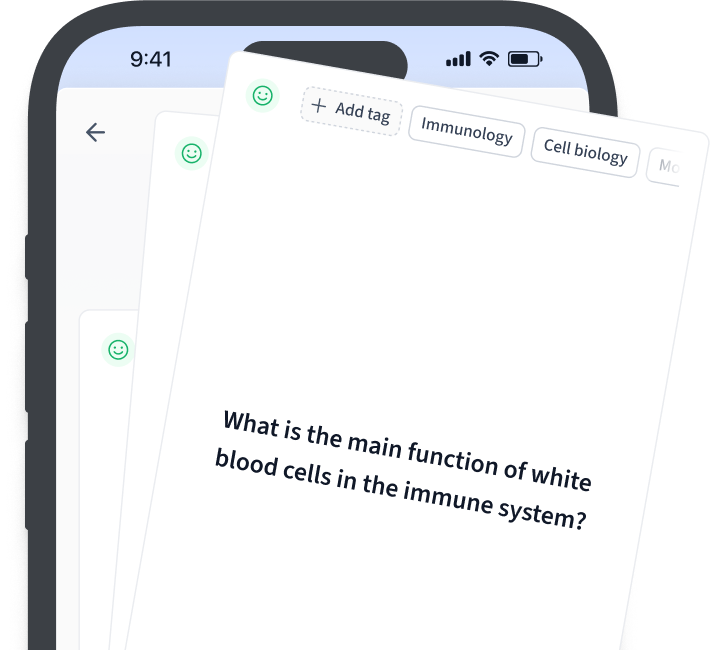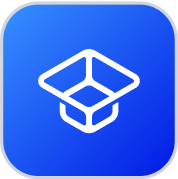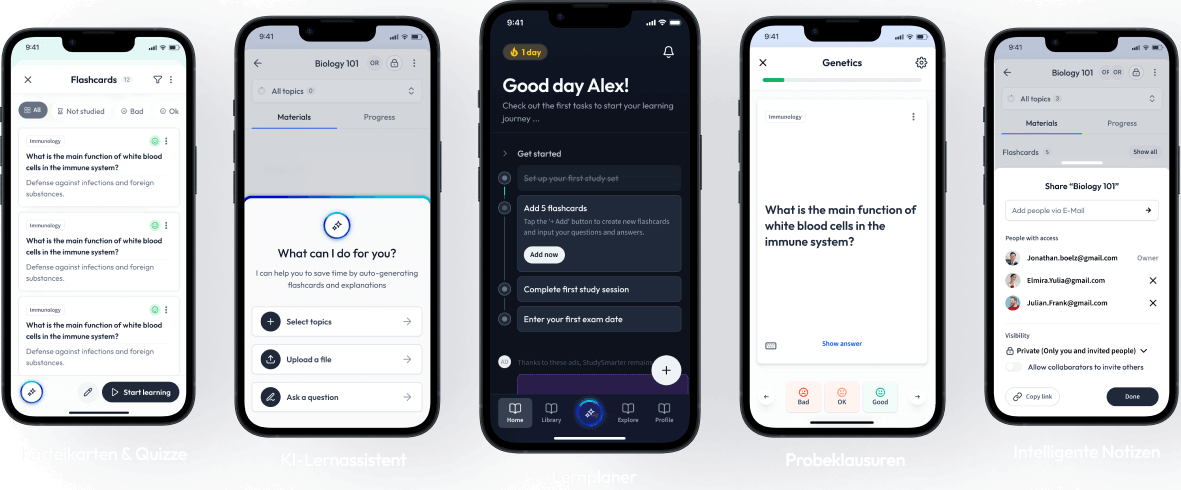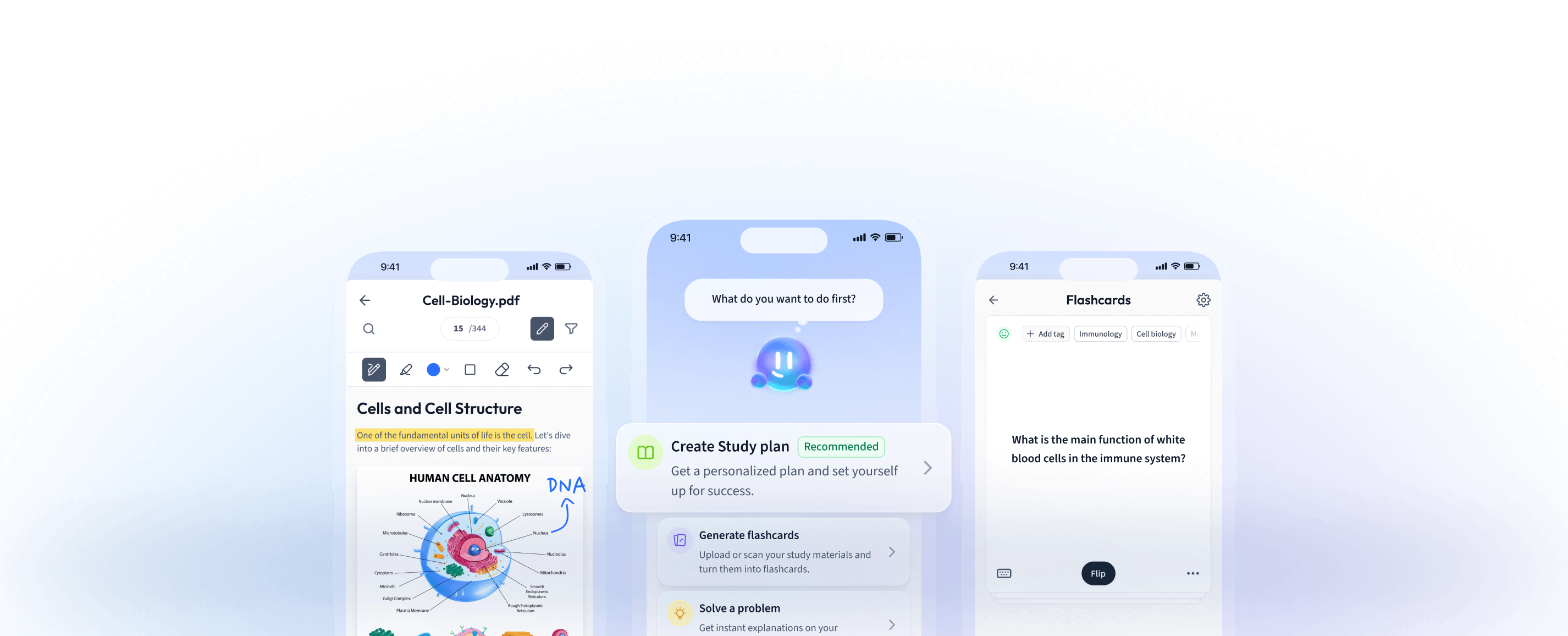Ähnlich kannst Du Dir den Ablauf der G-Protein gekoppelten Rezeptoren (kurz: GPCR) vorstellen. Sie spielen in diesem Szenario die Rolle der Klingel, ohne sie kommt die gewünschte Information nicht an ihr Ziel. Diese GPCRs sind also entscheidend an der Informationsübertragung Deines Körpers beteiligt.
G-Protein gekoppelte Rezeptoren – Definition
Die Zellen Deines Körpers haben grundlegend einen verwandten Aufbau und sind von einer doppelten Schicht aus Fetten (Phospholipiden) umgeben (Biomembran). Damit grenzen sie ihr Milieu von dem äußeren Milieu zwischen den Zellen ab.
Nun haben Deine Zellen verschiedenste Aufgaben. Sie sollen also alle in der Lage sein, auf unterschiedliche Signale zu reagieren. Dafür gibt es spezifische Rezeptoren an ihrer Oberfläche und im Innenraum. Damit ist eine selektive Zellantwort durch den Rezeptor möglich und Botenstoffe (Transmitter) wirken an ihrem gewünschten Zielort. Dieser Vorgang wird in der Biologie als Signaltransduktion bezeichnet. Eine Art dieser Rezeptoren bilden die GPCRs.
Die G-Protein gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) sind dabei solche, die in der Zellmembran verankert sind und diese durchdringen (Transmembranprotein). Dadurch können sie durch Transmitter außerhalb der Zelle aktiviert werden und in der Zelle (intrazellulär) in Signal auslösen. Außerdem zählt man sie zu den metabotropen Rezeptoren. Sie stoßen nämlich eine Signalkaskade in der Zelle an. Dazu erfährst Du in den weiteren Abschnitten des Artikels mehr.
Transmembranproteine (auch integrale Proteine) sind Proteine, welche über den gesamten Querschnitt einer Biomembran in ihr eingelagert sind.
G-Protein gekoppelte Rezeptoren – Aufbau
G-Protein gekoppelte Rezeptoren haben eine oder mehrere Bindungsstellen für ihr Botenstoffe. Die Botenstoffe werden in diesem Zusammenhang mit einem Rezeptor als Liganden bezeichnet. Die Stelle, an der sie binden, bezeichnet man somit als Ligandenbindungsstelle.
Die Ligandenbindungsstelle liegt extrazellulär, sodass die gewünschten Botenstoffe an sie binden können. Dabei durchdringen die G-Protein gekoppelten Rezeptoren die Zellmembran und lösen ein intrazelluläres Signal aus. Verantwortlich dafür ist die intrazelluläre Anteil, der die Zellantwort ermöglicht.
Der Anteil des Rezeptors, welcher sich innerhalb der Membran befindet, wird als Transmembrandomäne bezeichnet.
Transmembrandomänen, wie sie in den GPCRs vorkommen, sind gewundene Anteile der Rezeptoren, welche die Membran durchziehen. Die G-Protein gekoppelten Rezeptoren bestehen aus jeweils sieben Transmembran-Anteilen.
Um auf die Signale, die sie bekommen, reagieren zu können, benötigen G-Protein gekoppelte Rezeptoren zusätzlich eine an den Liganden angepasste Ligandenbindungsstelle. Diese Stelle des Rezeptors besteht meist aus Zuckermolekülen, die spezifisch für den jeweiligen Liganden sind.
Auf der anderen Seite, im Inneren der Zelle, liegen die Andockstellen für die G-Proteine.
Die Liganden der G-Protein gekoppleten Rezeptoren sind sehr divers. Dabei können sowohl Hormone, als auch Neurotransmitter an die Rezeptoren binden und ein entsprechendes Signal auslösen.
Aufbau G-Proteine
Es gibt verschiedene G-Proteine, welche alle einem grundlegend ähnlichen Aufbau folgen. Sie besitzen eine alpha-, beta- und gamma-Untereinheit. Beim g-Protein handelt es sich also um ein Trimer (drei Untereinheiten). An der alpha-Untereinheit befindet sich eine GTP-Bindungsstelle.
GTP ist, ähnlich wie ATP, eine Energiewährung Deines Körpers. Es besteht aus einer Base und einem Zucker und drei Phosphatresten (Nukleotid). Wenn die Phosphatreste abgespalten werden, dann wird Energie frei. Die frei werdende Energie kann für Reaktionen im Körper genutzt werden. Wenn ein Phosphat vom GTP abgespalten wird, spricht man vom GDP, bei zwei abgespaltenen vom GMP. Diese Formen sind jeweils energieärmer.
Die G-Proteine sitzen im inaktiven Zustand an Rezeptoren und werden durch sie aktiviert. Das G-Protein mit passendem Rezeptor bezeichnet man in der Gesamtheit als G-Protein gekoppelte Rezeptoren.
G-Protein gekoppelte Rezeptoren – Ablauf Reaktion
Die Reaktion der G-Protein gekoppelten Rezeptoren folgt grundsätzlich einem identischen Schema:
Der Rezeptor liegt unbesetzt vor und das G-Protein ist inaktiv an ihn gebunden. Das bedeutet, dass die alpha Untereinheit des GPCRs ein energiearmes GDP gebunden hat.
Es bindet ein Ligand an den Rezeptor. Dadurch geschieht am Rezeptor eine räumliche Änderung (Konformationsänderung). Diese überträgt sich auf das G-Protein. Dies bildet die Kopplung der GPCRs. Durch die Aktivierung aufgrund des Rezeptors wird an der alpha-Untereinheit GDP mit energiereichem GTP ausgetauscht. Dieses geschieht durch Austauschfaktoren, sogenannte GEFs (= GTP-exchange factor bzw. GTP Austauschfaktor). Das G-Protein liegt nun im aktivierten Zustand vor.
Die alpha-Untereinheit mit dem energiereichen GTP löst sich von den anderen beiden Untereinheiten und damit vom Rezeptor und kann spezifische intrazelluläre Signale auslösen.
Nach kurzer Zeit wird das GTP durch sogenannte GAPs (= GTPase activating proteins bzw. GTPase aktivierende Proteine) gespalten und die alpha Untereinheit liegt inaktiv vor. Der Ligand löst sich vom Rezeptor.
Wenn die alpha Untereinheit wieder an die anderen Untereinheiten bindet und der Ligand vom Rezeptor gelöst ist, gilt die Reaktion als abgeschlossen. Es kann ein neues Signal eines weiteren Liganden am Rezeptor erfolgen.
Funktion der Adenylatcyclase
Die alpha-Untereinheit kann unter anderem in ihrer aktivierten Form die Adenylatcyclase aktivieren, welche den intrazellulären Botenstoff cAMP herstellt. cAMP ist als sogenannter second-messenger verantwortlich für die Aktivierung verschiedener Prozesse in der Zelle. Den first-messenger stellt der Ligand dar, der an den Rezeptor bindet. Dadurch wird die gewünschte Signaltransduktion gewährleistet. Die GPCRs haben als eine der wichtigsten Aufgaben die Regulation der cAMP Konzentration in der Zelle.
cAMP kann, wenn es als second-messenger an die intrazelluläre Proteinkinase A bindet, verschiedene Reaktionen als Ziel der Signaltransduktion auslösen. Die Proteinkinase A sorgt dabei auch für die Aktivierung und Ablesung verschiedener Gene. cAMP ist also an der sogenannten Regulation der Genexpression beteiligt.
Die G-Protein gekoppelten Rezeptoren lösen in der Regel keine direkten Reaktionen in der Zelle aus. Die GPCRs sind dafür zuständig, andere Signalmoleküle zu aktivieren. Dadurch kann ein Hormonsignal, welches im Blut nur einige nmol ausmacht, durch die G-Proteine und deren Wirkmechanismus zu einem starken intrazellulären Signal führen. Diese Aktivierung und Erhöhung der Signalstärke durch GPCRs bezeichnet man als Signalkaskade.
Cholera (Choleratoxin) ist eine Erkrankung, die im Zusammenhang mit den G-Proteinen steht. Dort sorgt das Toxin dafür, dass die alpha Untereinheit der G-Proteine dauerhaft GTP gebunden hat. Dies sorgt für eine ständige Aktivierung der Adenylatcyclase in den Darmepithelzellen. Daraufhin steigt die Natrium- und Wasserausscheidung im Darm. Dies führt zur Diarrhö und damit zum Wasserverlust des Körpers.
Hemmung der Signalkaskade
Die meisten Liganden sind Agonisten. Das beutetet, dass sie eine Konformationsänderung am Rezeptor hervorrufen und damit intrazellulär eine Reaktion stattfinden kann. Manche Antagonisten können aber auch an den GPCR binden. Dadurch wird dieser vorübergehend blockiert. Es kann in diesem Zustand kein Signal in der Zelle durch die Wirkung des Rezeptors erfolgen. Das wiederum kann beispielsweise die zelluläre Konzentration von cAMP senken.
G-Protein gekoppelte Rezeptoren – Arten
Es gibt verschiedene Arten G-Protein gekoppelter Rezeptoren. Die Einteilung erfolgt hierbei aufgrund ihrer unterschiedlichen Wirkung.
Gs-gekoppelte Rezeptoren
Eine Klasse der G-Protein gekoppelten Rezeptoren sind die Gs-gekoppelten Rezeptoren. Der Buchstabe S steht hierbei für stimulierend, sie sind also an stimulierenden Signalprozessen beteiligt. Sogenannte Gi-gekoppelten Rezeptoren stehen den Gs-gekoppelten Rezeptoren gegenüber.
Ein Beispiel für die Wirkung der Gs-gekoppelten Rezeptoren ist der Glykogenabbau. Dabei sorgt die Adenylatcyclase und cAMP dafür, dass Enzyme aktiviert werden. Diese Enzyme spalten die Speichermoleküle für Zucker, genannt Glykogen, in einzelne Zuckermoleküle. Diese Zuckermoleküle können wiederum im Stoffwechsel zu Energiegewinnung genutzt werden.
Gi-gekoppelte Rezeptoren
Die Gi-gekoppelten Rezeptoren sorgen für eine hemmende Wirkung. Das I steht für Inhibition, was so viel wie Hemmung bedeutet. Die Gi-Rezeptoren wirken hemmend auf die Adenylatcyclase, dämmen also die Produktion des second-messengers cAMP ein.
Die Gi-gekoppelten Rezeptoren wirken hemmend auf die Herzmuskelzellen. Dadurch wird die Herzmuskulatur entspannt, was beispielsweise im Ruhezustand oder bei Entspannung der Fall ist.
G-Protein gekoppelte Rezeptoren – Das Wichtigste
- Der GPCR ist ein Rezeptor, der mit seinen sieben Transmembranhelices die Zellmembran durchzieht. Dabei hat dieser GPCR intrazellulär eine Bindungsstelle für G-Proteine und außen für ihre spezifischen Liganden.
- Ein GPCR sorgt dafür, dass außen ein Botenstoff (Ligand) binden kann, und innen in der Zelle dadurch eine spezifische Reaktion ausgelöst wird. Dies bezeichnet man als Signaltransduktion.
- Durch die Bindung des Liganden ändert sich die Raumstruktur des GPCRs und am G-Protein kann ein energiereiches Molekül (GTP) binden.
- Die aktivierte alpha-Untereinheit aktiviert die Adenylatcyclase, welche den wichtigen intrazellulären Botenstoff cAMP produziert. Dieses cAMP fungiert hierauf als second-messenger. Dadurch werden verschiedene Signalprozesse, spezifisch für die jeweilige Zelle, in Gang gesetzt.
- Es gibt verschiedene Arten der GPCRs. Die Gs-gekoppelten Rezeptoren wirken stimulierend, die Gi-gekoppelten Rezeptoren hemmend (inhibierend).
Nachweise
- Müller-Esterl (2018). Biochemie: Eine Einführung für Mediziner und Naturwissenschaftler. Springer Spektrum
- next.amboss.com: Signaltransduktion. (20.08.22)
Wie stellen wir sicher, dass unser Content korrekt und vertrauenswürdig ist?
Bei StudySmarter haben wir eine Lernplattform geschaffen, die Millionen von Studierende unterstützt. Lerne die Menschen kennen, die hart daran arbeiten, Fakten basierten Content zu liefern und sicherzustellen, dass er überprüft wird.
Content-Erstellungsprozess:
Lily Hulatt ist Digital Content Specialist mit über drei Jahren Erfahrung in Content-Strategie und Curriculum-Design. Sie hat 2022 ihren Doktortitel in Englischer Literatur an der Durham University erhalten, dort auch im Fachbereich Englische Studien unterrichtet und an verschiedenen Veröffentlichungen mitgewirkt. Lily ist Expertin für Englische Literatur, Englische Sprache, Geschichte und Philosophie.
Lerne Lily
kennen
Inhaltliche Qualität geprüft von:
Gabriel Freitas ist AI Engineer mit solider Erfahrung in Softwareentwicklung, maschinellen Lernalgorithmen und generativer KI, einschließlich Anwendungen großer Sprachmodelle (LLMs). Er hat Elektrotechnik an der Universität von São Paulo studiert und macht aktuell seinen MSc in Computertechnik an der Universität von Campinas mit Schwerpunkt auf maschinellem Lernen. Gabriel hat einen starken Hintergrund in Software-Engineering und hat an Projekten zu Computer Vision, Embedded AI und LLM-Anwendungen gearbeitet.
Lerne Gabriel
kennen