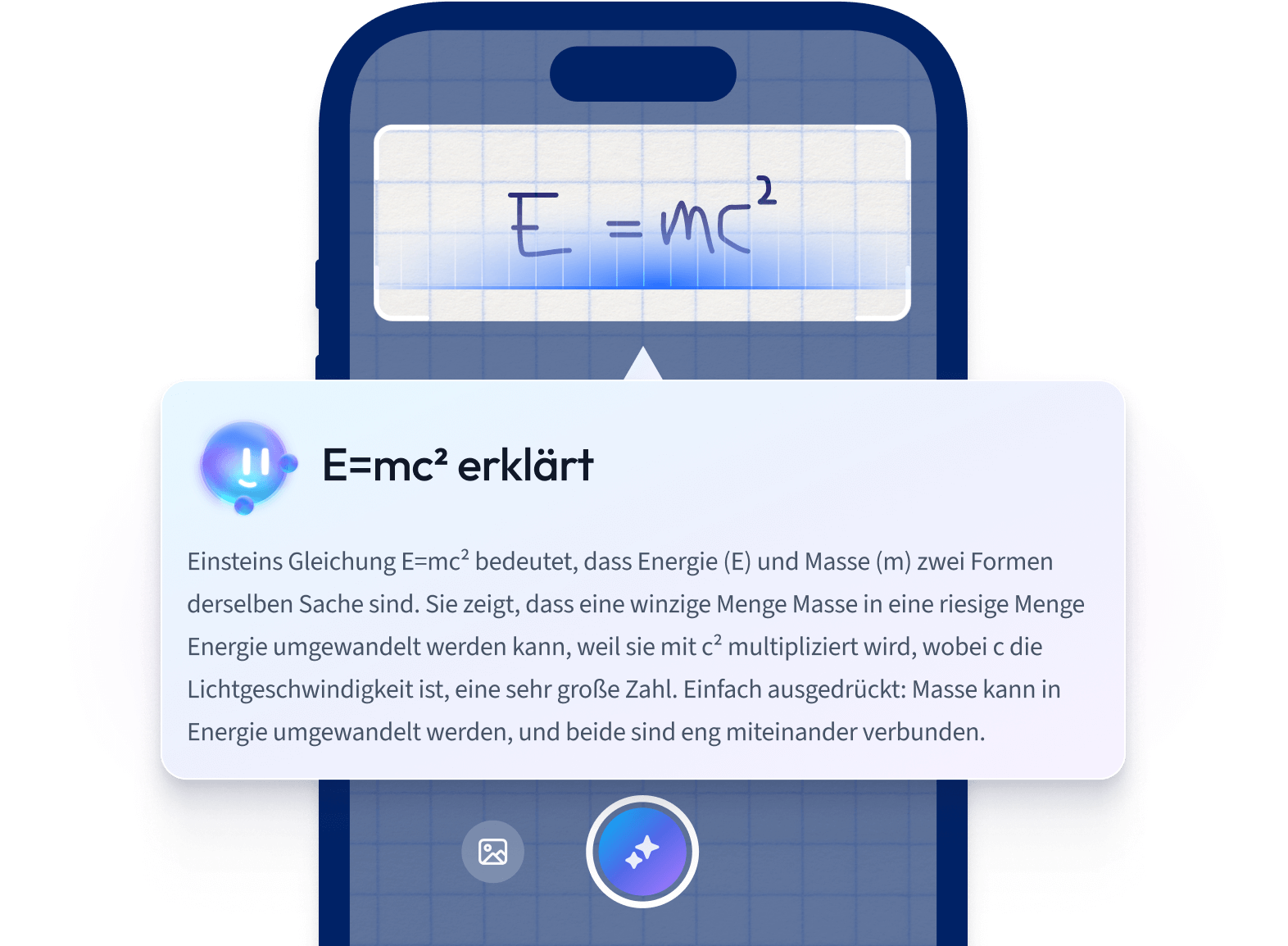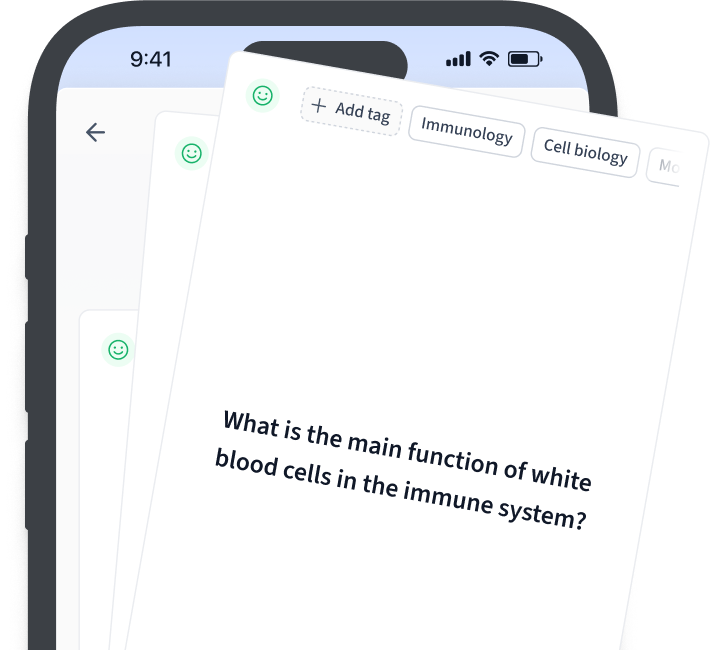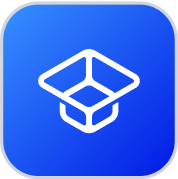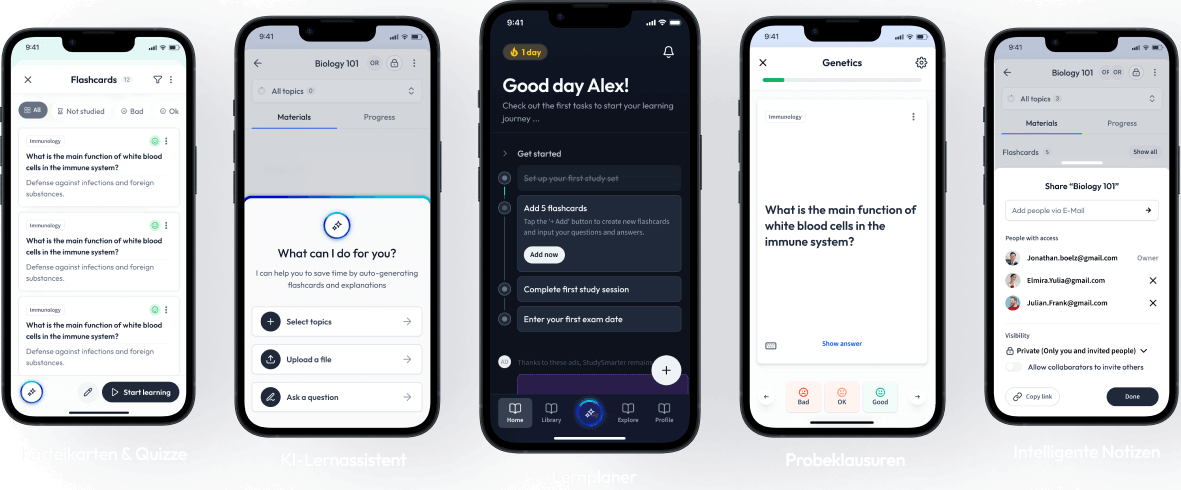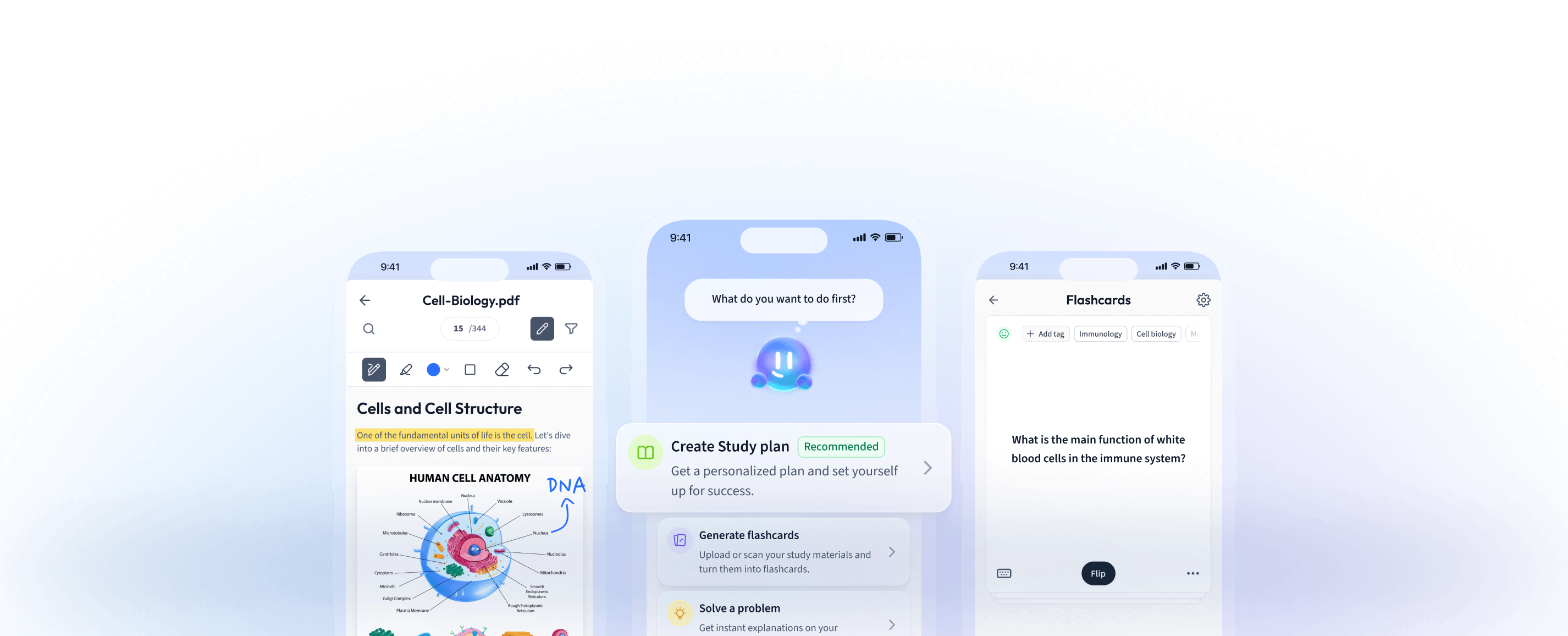Kanzone & Kanzonenform – Definition
Die Kanzonenstrophe tritt als Strophenart in einer Kanzone auf:
Die Kanzone (vom Italienischen canzone, "Lied") beschreibt ursprünglich eine Liedform, die im Mittelalter beliebt war und Elemente einer Ode aufzeigt. Später wurde die Kanzone von Dichterinnen und Dichtern auch als Gedichtform verwendet. Sie besteht aus Kanzonenstrophen, die sich durch einen Auf- und Abgesang kennzeichnen.
Die Kanzonenstrophe galt im Mittelalter als besonders festliche Dichtungsart und wurde in Begleitung von Musik vorgesungen.
Bei der Ode handelt es sich um eine Gedichtform, die ursprünglich aus der griechischen Antike stammt. Sie ist gekennzeichnet durch einen anspruchsvollen sprachlichen Stil, was sie besonders festlich macht. In der Antike wurden Oden in Begleitung von Musik vorgetragen. Auch deutsche Dichterinnen und Dichter probierten sich an dieser Gedichtform. Bekannte Vertreter der Neuzeit sind z. B.
- Friedrich Hölderlin und
- Friedrich Gottlieb Klopstock.
Bei Oden handelt es sich meistens um längere Gedichte ohne Reime.
Kanzonenstrophe – Aufbau
Der Aufbau einer Kanzone lässt sich wie folgt zusammenfassen:
- fünf bis sieben Kanzonenstrophen
- eine Strophe gliedert sich in drei Gruppen, die auch Stollen genannt werden
- ersten beiden Teile einer Kanzonenstrophe = Aufgesang
- letzter Teil = Abgesang
Kanzonenstrophe – Merkmale
Eine Kanzonenstrophe geht mit gewissen Merkmalen einher, die in der folgenden Tabelle erläutert werden.
| Merkmal | Erläuterung |
| Aufgesang ist symmetrisch | - die ersten beiden Stollen sind metrisch identisch
- die Verse haben also dieselbe Anzahl an Hebungen und das gleiche Reimschema
|
| Jambus | - Metrum oft ein Jambus (unbetont – betont)
- andere Versmaße sind aber auch möglich
|
| Abgesang länger, oft reimlos | - der Abgesang ist der dritte Stollen
- er wird auch "Coda" genannt
- er ist oft länger als der Aufgesang
- kann reimlos sein (dann: Waise)
|
Als Waise wird das Phänomen bezeichnet, ein oder mehrere Verse keinen Reim aufweisen, obwohl die restlichen Verse des Gedichts ein Reimschema haben.
Vers und Versmaß
- Verse = die einzelnen Zeilen eines Gedichts
- Verse haben metrische Eigenschaften (eine bestimmte Anzahl von Senkungen und Hebungen)
- Versmaß = Regelmäßigkeiten in Senkungen und Hebungen
Strophe
- Strophe = Abschnitt eines Gedichts oder Lieds
- setzt sich aus einzelnen Versen zusammen
- meistens durch Absätze voneinander getrennt
- Charakteristika z. B. Verslänge, Reimschema oder Metrum
Reimschema
- beschreibt, in welchem Muster sich die Versenden aufeinander reimen.
- z. B. Paarreim = aabb
- z. B. Kreuzreim = abab
Kanzonenstrophe – Beispiel: Kanzonenstrophe Minnesang an Lieder erklärt
Im Folgenden findest Du ein Beispiel für eine Kanzonenstrophe aus dem Minnesang-Lied "Diu vil guote", das von Heinrich von Morungen verfasst wurde:
Ich muoz sorgen a
wenn diu lange naht zergê b (1. Stollen)
gegen dem morgen a
daz ichs einest an gesê b (2. Stollen)
Mîn vil liebe sunnen, diu mir sô wunnenclîchen taget, c
daz mîn ouge ein trüebez wolken wol verklaget. c (3. Stollen) 1
In diesem Gedicht hofft das lyrische Ich, dass die Nacht bald endet, damit es seine Geliebte sehen kann. Es vergleicht ihre Schönheit mit der Sonne, die nicht einmal eine Wolke vertrüben könnte.
Bei dem lyrischen Ich handelt es sich um die Sprecherin oder den Sprecher eines Textes. Das lyrische Ich ist dabei eine erfundene Stimme und nicht mit der Autorin oder dem Autor gleichzusetzen. Um mehr über das Thema zu erfahren, lies Dir gerne die Erklärung "Lyrisches Ich" durch!
Ich muoz sorgen a
wenn diu lange naht zergê b (1. Stollen)
gegen dem morgen a
daz ichs einest an gesê b (2. Stollen)
In den ersten beiden Stollen liegt im jeweils ersten Vers ein zweihebiger Trochäus vor. Zweihebig bedeutet, dass in dem Vers zwei Hebungen vorliegen, dass also zwei Silben betont werden. In diesem Fall sind das die Silben "ich" und "sorg-". Der Trochäus ist dabei ein Versmaß, bei dem sich betonte mit unbetonten Silben abwechseln, wie das hier der Fall ist. Der Vers endet in einer weiblichen Kadenz.
Der zweite Vers der beiden Stollen hat einen vierhebig Trochäus als Versmaß und endet je auf eine männliche Kadenz.
Die Kadenz beschreibt die Betonung des Versendes in einem Gedicht. Ist die letzte Silbe eines Gedichts betont, liegt eine männliche Kadenz vor. Ist die letzte Silbe hingegen unbetont, so wird von einer weiblichen Kadenz gesprochen.
Die Verse sind dabei durch einen Kreuzreim (abab) miteinander verbunden. Hier sind also der erste sowie der zweite Stollen metrisch identisch.
Reimen sich die Verse einer Strophe abwechselnd aufeinander, so liegt ein Kreuzreim vor. Schau Dir doch die Erklärung zu "Kreuzreim" oder auch zu "Reimschema" allgemein an, um mehr darüber zu erfahren.
Mîn vil liebe sunnen, diu mir sô wunnenclîchen taget, c
daz mîn ouge ein trüebez wolken wol verklaget. c (3. Stollen)
Im dritten Stollen sind Metrum und Reimschema unabhängig von den vorausgegangenen Stollen. Der erste Vers ist ein siebenhebiger Trochäus, es liegen also sieben betonte Silben vor. Die erste betonte Silbe ist "Mîn", dann folgt eine unbetonte Silbe, woraufhin die nächste Silbe wieder betont wird usw. Der zweite Vers ist ein sechshebiger Trochäus. Insgesamt sind die Verse des dritten Stollens auch länger als die Verse der ersten beiden Stollen. Es liegt ein Paarreim (cc) mit weiblicher Kadenz vor.
Reimen sich die Verse eines Gedichts, die direkt aufeinanderfolgen, liegt ein Paarreim vor. Schau Dir doch auch die Erklärung zu "Paarreim" an, um Dich in das Thema einzulesen.
Kanzonenstrophe – Minnesang
Die Kanzone war eine gern verwendete Liedform im sogenannten Minnesang des Mittelalters.
Der Minnesang bezeichnet die Sangspruchdichtung des Mittelalters und leitet sich von dem mittelhochdeutschen Wort Minne, das Liebe bedeutet, ab. Häufig steht die unerfüllbare Liebe des Sängers zu einer adeligen Dame im Vordergrund. Die Liebe kann nicht erfüllt werden, da die beiden nicht demselben Stand angehören.
Die Kanzonenstrophe hat ihren Ursprung in der französischen Troubadourlyrik und wurde später von italienischen Dichtern entdeckt. Troubadouren waren mittelalterliche Dichter, die an den Höfen von Königinnen und Königen Lieder schrieben und diese auch vorsangen.
Schließlich benutzten auch viele bekannte deutsche Dichter die Kanzonenstrophe für ihre Lieder, wie
- Walther von der Vogelweide,
- Hartmann von Aue und
- Heinrich von Morungen.
Da bis heute nur Gedichte männlicher Dichter dieser Epoche überliefert sind, findest Du hier nur die männliche Form.
Der italienische Dichter Petrarca entwickelte auf Basis der Kanzonenstrophe die Gedichtform des Sonetts. Dieses folgt einem ähnlichen Schema: Die ersten beiden Strophen, die sogenannten Quartette, ähneln sich metrisch, während die letzten beiden Strophen, die Terzette, wieder eine Einheit bilden.
Um Dich in das Thema zu vertiefen, schau Dir gerne den Artikel zu "Sonett" an!
Kanzonenstrophe – Beispiel Neuzeit
Die Kanzonenstrophe wurde auch in der Neuzeit in der Epoche der Romantik benutzt, z. B. von August Wilhelm Schlegel. Der Auszug aus Schlegels Gedicht "Aus einem unbekannten Roman" aus dem Jahr 1796 zeigt, wie er Elemente des Aufbaus der mittelalterlichen Kanzonenstrophe in seine Lyrik übernimmt:
Die Jugend flieht, die Hofnung ist zerronnen,Des Lebens Blüthen fallen welkend ab, (1. Stollen)
Und unerreichbar fern sind meine Wonnen,Und stumm und einsam bin ich, wie ein Grab. (2. Stollen)
Im ganzen weiten Reich der
WesenHast du allein die Zaubermacht,Mich von dem Gram zu lösen,Der jeden Trost verlacht. 3
Die ersten beiden Stollen sind je zwei Verse lang und metrisch identisch. Die Verse weisen alle einen fünfhebigen Jambus auf und reimen sich in einem Kreuzreim. Weibliche und männliche Kadenzen wechseln sich dabei ab.
Der dritte Stollen hingegen hat vier Verse und unterscheidet sich metrisch von den ersten beiden Stollen. Hier sind die ersten beiden Verse vierhebig jambisch, die beiden letzten Verse weisen drei Hebungen auf. Der dritte Stollen hat also insgesamt mehr Verse als die ersten beiden Stollen, wobei seine Verse auch weniger Hebungen aufweisen.
Inhaltlich ähnelt Schlegels Gedicht an den typischen Liebesgesang des Mittelalters. Hier verehrt er seine Geliebte, deren Zuneigung alles Leid in seinem Leben besser macht.
Um Dich in das Thema zu vertiefen, schau Dir die Erklärung zur Epoche der "Romantik" an!
Langzeilen und Kanzonenstrophen – Unterschied
Die Kanzonenstrophe und Langzeilenstrophe ähneln sich in einigen Aspekten, weshalb sie miteinander verwechselt werden können. Jedoch besteht zwischen ihnen auch ein Unterschied.
Unter der Langzeile versteht man ein Versmaß, das aus einem An- und einem Abvers besteht. Die beiden Teilverse werden meistens durch einen Stabreim miteinander verbunden. Zudem wird ein Vers durch eine Zäsur, also eine Sprechpause, geteilt. Ein Vers kann dabei unterschiedliche Hebungen haben. Zusammen ergeben sie eine rhythmische Einheit. Das Reimschema der Versenden ist in den meisten Fällen ein Paarreim.
Ein Stabreim liegt vor, wenn aufeinanderfolgende Wörter in einem Vers mit demselben Buchstaben beginnen. Dieses Stilmittel kennst Du vielleicht bereits als Alliteration. Unter einer Zäsur wird eine natürliche Sprechpause verstanden.
Meistens besteht eine Langzeilenstrophe aus vier Langzeilen, die paarweise gereimt sind. Eine der bekanntesten Langzeilenstrophen entstammt dem Nibelungenlied:
Uns ist in alten mæren II wnders vil geseit a
von heleden lobebæren II von grôzer arebeit a
von frevde vn– hôchgecîten, II von weinen vn– [von] klagen, b
von kvner recken strîten II mvget ir nv wnder horen sagen. b
In dieser einleitenden Strophe des Nibelungenlieds liegt ein Paarreim (aabb) vor, außerdem kommt es in der Mitte der Verse zu Zäsuren, also zu Atempausen. Auch liegt in Vers 2 und 3 jeweils ein Stabreim vor, die Teilverse beginnen also mit demselben Buchstaben.
Zäsuren treten in einer Kanzonenstrophe nicht auf, bei einer Langzeile sind sie jedoch das entscheidende Merkmal. Bei einer Kanzonenstrophe kann das Reimschema zudem frei gewählt werden. Bei einer Langzeile hingegen treten in der Regel Stabreime innerhalb des Verses auf, die Versenden reimen sich dabei im Paarreim aufeinander. So lässt sich die Langzeile von der Kanzonenstrophe unterscheiden.
Kanzonenstrophe – Das Wichtigste
- Kanzone & Kanzonenform – Definition:
- Liedart, die besonders im Mittelalter beliebt war
- weist Elemente der Ode auf
- Kanzonenstrophe – Aufbau:
- eine Kanzone besteht aus 5–7 Kanzonenstrophen
- eine Strophe gliedert sich in drei Gruppen (Stollen)
- ersten beiden Teile einer Kanzonenstrophe = Aufgesang
- letzter Teil = Abgesang
- Kanzonenstrophe – Merkmale:
- Aufgesang ist symmetrisch (metrisch identisch)
- Metrum oft ein Jambus
- Abgesang länger, oft reimlos
- Kanzonenstrophe – Beispiel: Kanzonenstrophe Minnesang an Lieder erklärt:
- Kanzone stammt aus provinzalischer Troubadourlyrik
- Verwendung in mittelhochdeutschem Minnesang
- bspw. "Diu vil guote" von Heinrich von Morungen
- Kanzonenstrophe – Minnesang: Der Minnesang war die mittelalterliche Sangspruchdichtung und handelte meistens von der unerfüllten Liebe des Sängers zu einer adeligen Dame. Deutsche Dichter waren z. B.
- Walther von der Vogelweide,
- Hartmann von Aue und
- Heinrich von Morungen.
- Langzeilen und Kanzonenstrophen – Unterschied:
- Die Langzeile hat innerhalb des Verses eine Zäsur (Sprechpause)
- Stabreime innerhalb des Verses
- Paarreim bei Versenden
Nachweise
- Lachmann (1988). Des Minnesangs Frühling. S. Hirzel Verlag Stuttgart.
- Hoffmann (1981). Altdeutsche Metrik. J. B. Metzler.
- Behler (1967). Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe. Erste Abteilung. Kritische Ausgabe. Verlag Ferdinand Schoningh.
Wie stellen wir sicher, dass unser Content korrekt und vertrauenswürdig ist?
Bei StudySmarter haben wir eine Lernplattform geschaffen, die Millionen von Studierende unterstützt. Lerne die Menschen kennen, die hart daran arbeiten, Fakten basierten Content zu liefern und sicherzustellen, dass er überprüft wird.
Content-Erstellungsprozess:
Lily Hulatt ist Digital Content Specialist mit über drei Jahren Erfahrung in Content-Strategie und Curriculum-Design. Sie hat 2022 ihren Doktortitel in Englischer Literatur an der Durham University erhalten, dort auch im Fachbereich Englische Studien unterrichtet und an verschiedenen Veröffentlichungen mitgewirkt. Lily ist Expertin für Englische Literatur, Englische Sprache, Geschichte und Philosophie.
Lerne Lily
kennen
Inhaltliche Qualität geprüft von:
Gabriel Freitas ist AI Engineer mit solider Erfahrung in Softwareentwicklung, maschinellen Lernalgorithmen und generativer KI, einschließlich Anwendungen großer Sprachmodelle (LLMs). Er hat Elektrotechnik an der Universität von São Paulo studiert und macht aktuell seinen MSc in Computertechnik an der Universität von Campinas mit Schwerpunkt auf maschinellem Lernen. Gabriel hat einen starken Hintergrund in Software-Engineering und hat an Projekten zu Computer Vision, Embedded AI und LLM-Anwendungen gearbeitet.
Lerne Gabriel
kennen