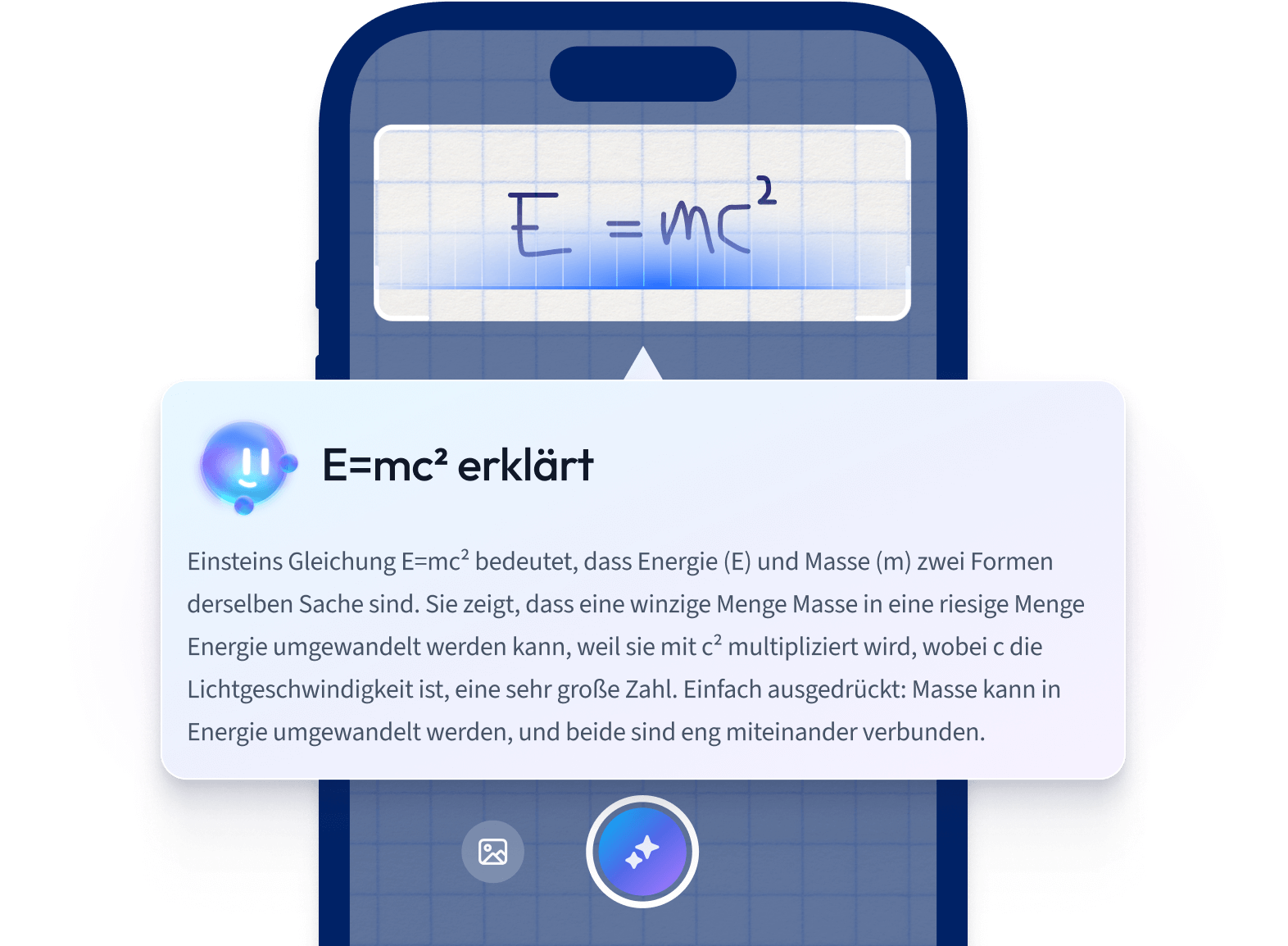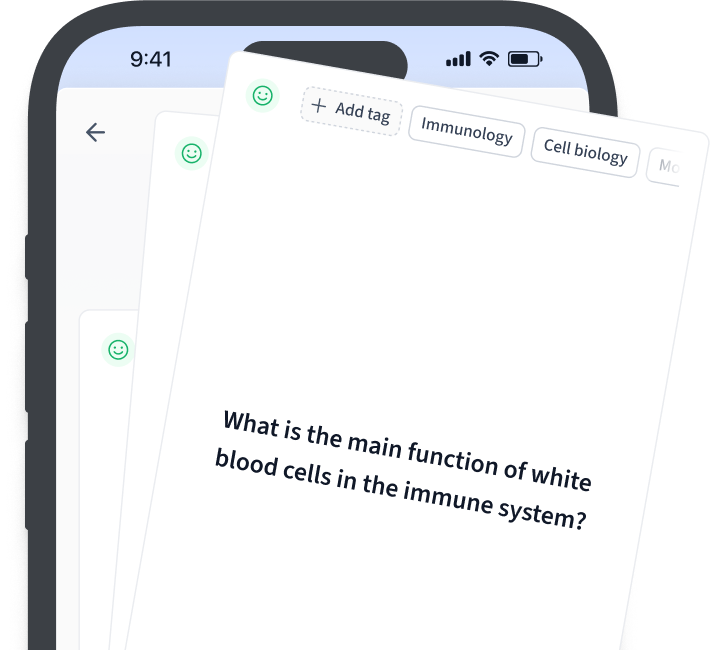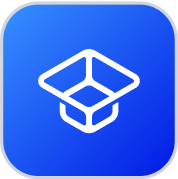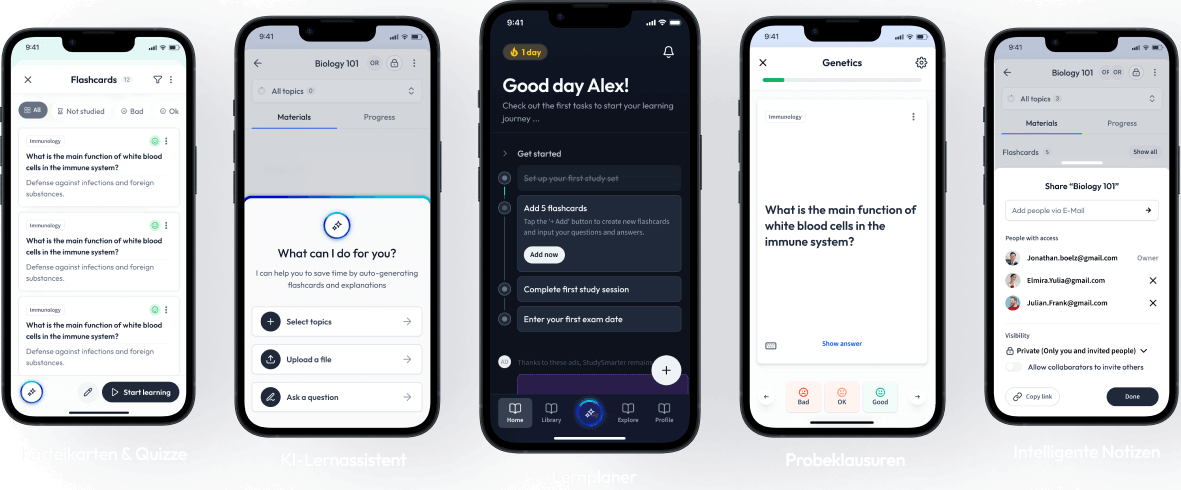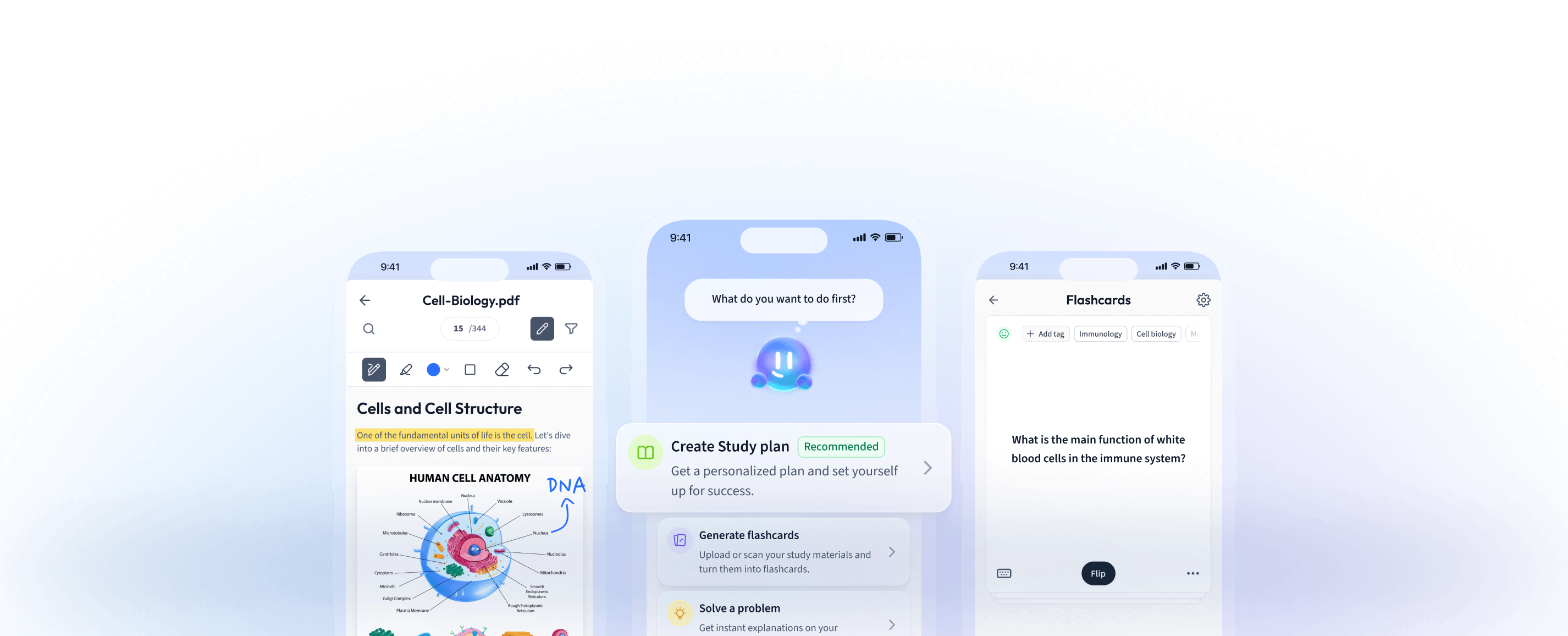Investiturstreit – Historischer Kontext
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation im 11. Jahrhundert:
Die Macht der katholischen Kirche war in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend gewachsen. Die europäische Gesellschaft im Mittelalter war sehr religiös, dementsprechend groß war auch der Einfluss der Kirche und der Geistlichen auf die Menschen.
Der Reichtum und die Ländereien der Kirche vergrößerten sich immer mehr, entweder durch Schenkungen von Adeligen oder aber durch Steuerabgaben wie dem Zehnt (so musste etwa jeder Bauer/ jede Bäuerin 10 % ihres landwirtschaftlichen Ertrages an die Kirche abtreten).
So wurden im Mittelalter die Bischöfe und andere hohe Geistliche neben dem römisch-deutschen König/Kaiser selbst und den adeligen Fürsten zu den vermögendsten und einflussreichsten Personen im Reich.
Investiturstreit – Ursachen
Doch egal, wie einflussreich die Bischöfe waren, in der machtpolitischen und gesellschaftlichen Hierarchie stand der römisch-deutsche König/Kaiser über ihnen. Im Mittelalter legitimierten die Könige und Kaiser Europas ihre Herrschaft durch das Gottesgnadentum. Sie behaupteten also, dass sie von Gott für ihre Position auserwählt waren.
Und auch der römisch-deutsche König/Kaiser stützte seine Herrschaft darauf – und deshalb wurde er auch als der direkte Diener Gottes im Reich angesehen. Die Aufgabe der Bischöfe war es wiederum, dem König mit helfender Hand zur Seite zu stehen und ihn bei der Wahrung der gottgegebenen Ordnung im Reich zu unterstützen.
Investitur durch den weltlichen Herrscher
Da die Bischöfe im Mittelalter eine so wichtige Unterstützerrolle für den weltlichen Herrscher einnahmen, erscheint es logisch, dass auch der König/Kaiser dafür zuständig war, diese geistlichen Ämter zu besetzen.
Das Einsetzen eines Geistlichen in ein kirchliches Amt wird "Investitur" (Einkleidung) genannt.
Ein Bischof zum Beispiel wird mit einem Ring und einem Stab als Zeichen seines neuen Amtes "eingekleidet".
Im Heiligen Römischen Reich hatten dieses Recht auf Investitur seit vielen Jahren die weltlichen Herrscher beansprucht und ausgeübt. Das bedeutete: Der römisch-deutsche König/Kaiser entschied, wer zum Beispiel als Bischof ernannt wurde. So sicherte sich der König ab, indem er ihm treue Untergebene in die geistlichen Ämter einsetzte.
Weltliche und geistliche Macht waren damals also stark miteinander verbunden.
Die katholische Kirche bezeichnete diese weltliche Investitur von Geistlichen durch einen weltlichen Herrscher auch als Laieninvestitur.
 Abb. 1 - Darstellung einer Laieninvestitur. Der weltliche Herrscher (links) übergibt dem Bischof (rechts) den Stab als Zeichen seines neuen Amtes.
Abb. 1 - Darstellung einer Laieninvestitur. Der weltliche Herrscher (links) übergibt dem Bischof (rechts) den Stab als Zeichen seines neuen Amtes.
Reformbestrebungen der Kirche
Mitte des 11. Jahrhunderts stieß die Praxis der Laieninvestitur und die starke Verknüpfung zwischen weltlicher und geistlicher Macht zunehmend auf Unmut – sowohl in der religiösen Gesellschaft und vor allem auch bei der katholischen Kirche. Der Ruf nach einer Rückbesinnung auf die geistlichen Werte und nach einer vom weltlichen Herrscher unabhängigen Kirche wurde immer lauter.
Mit Papst Gregor VII. bestieg im Jahr 1073 schließlich ein Anhänger dieser Reformbewegung (auch "Reformpapsttum" genannt), den heiligen Stuhl im Vatikan.
Mittelalter Investiturstreit
Und Papst Gregor VII. war es schließlich auch, der 1075 offiziell verkündete, dass das Recht auf Investitur ausschließlich der Kirche zustehen sollte. Er forderte den damaligen römisch-deutschen König Heinrich IV. dazu auf, der römisch-katholischen Kurie das alleinige Investiturrecht einzuräumen.
Heinrich IV. dachte aber gar nicht daran, diese Forderung zu erfüllen und setzte ebenfalls im Jahr 1075 eigenmächtig einen neuen Bischof in Mailand ein. Papst Gregor VII. verurteilte dies scharf, forderte erneut das Recht auf Investitur für sich ein und drohte Heinrich IV. sogar mit der Exkommunikation (Ausschluss aus der katholischen Kirche).
Dies war der Beginn des sogenannten Investiturstreits.
Der römisch-deutsche König Heinrich IV. stammte übrigens aus dem Adelsgeschlecht der "Salier". Wenn Du mehr darüber und über die Person Heinrichs erfahren möchtest, dann wirf gerne einen Blick in die dazugehörige Erklärung!
Investiturstreit – Definition
Als "Investiturstreit" bezeichnet man einen Streit von 1075 bis 1122 zwischen den salischen Königen/Kaisern des Heiligen Römischen Reichs und dem Papsttum. Die Streitfrage war, ob es dem weltlichen Herrscher oder aber der katholischen Kurie zustand, das Recht auf Investitur im Heiligen Römischen Reich auszuüben.
Hauptsächlich wurde der Investiturstreit von Heinrich IV. und Papst Gregor VII. ausgetragen, doch auch deren Nachfolger hatten später noch mit dem Konflikt zu kämpfen.
Investiturstreit – Verlauf
Nachdem Papst Gregor VII. die Laieninvestitur in Mailand für Unrecht erklärt und Heinrich IV. offen mit der Exkommunikation gedroht hatte, reagierte der König prompt. Im Jahr 1076 tat sich Heinrich IV. mit einigen seiner treuen Bischöfe zusammen – gesammelt forderten sie Papst Gregor VII. dann dazu auf, sein Amt niederzulegen.
Als Reaktion auf dieses Absetzungsvorhaben
- belegte Papst Gregor VII. Heinrich IV. tatsächlich mit dem Kirchenbann und schloss ihn so aus der Kirche aus,
- und außerdem sprach der Papst dem König seine Herrschaft über das Heilige Römische Reich ab.
So etwas hatte es in der Geschichte des Reichs noch nie gegeben. Der Investiturstreit hatte einen neuen Höhepunkt erreicht und in den kommenden Jahren sollten sich die Ereignisse überschlagen.
Im Folgenden findest Du einen Überblick über einige der zentralen Geschehnisse des Investiturstreits:
| Investiturstreit Verlauf – Überblick |
| 1075 | - Papst Gregor VII. verkündete, dass das Recht auf Investitur dem Papst und der Kirche zustehen sollte.
- Der römisch-deutsche König Heinrich IV. beanspruchte das Recht auf Investitur aber weiter für sich.
- Der Papst forderte Heinrich IV. erneut mehrmals dazu auf, das Recht auf Investitur im HRR der Kirche zu überlassen.
- Auslöser Investiturstreit: Heinrich IV. ernannte eigenmächtig den neuen Bischof von Mailand.
- Als Reaktion drohte Papst Gregor VII. König Heinrich IV. mit der Exkommunikation.
|
| 1076 | - Heinrich IV. forderte Papst Gregor VII. dazu auf, sein Amt als Papst niederzulegen.
- Als Reaktion verhängte Papst Gregor VII. den Kirchenbann über Heinrich IV. und erkannte ihm seine Herrschaftsrechte über das HRR ab.
- Die deutschen Fürsten stellten Heinrich IV. ein Ultimatum: Der König musste den Kirchenbann innerhalb eines Jahres auflösen.
|
| Winter 1076–1077 | - Gang nach Canossa: Heinrich IV. trat einen Bußgang an und bat Papst Gregor VII. in Italien um Vergebung. Erstmals unterwarf sich ein römisch-deutscher König in einer solchen Art und Weise dem Papst.
- Der Papst löste Heinrichs IV. Kirchenbann auf und rehabilitierte ihn.
|
| bis 1077 | - Das HRR hatte sich in zwei politische Lager gespalten.
- Mit Rudolf von Rheinfelden wurde ein Gegenkönig zu Heinrich IV. gewählt.
|
| 1078 | - Papst Gregor VII. verkündete erstmals ein offizielles Verbot der weltlichen Laieninvestitur unter Androhung der Exkommunikation.
|
| 1080 | - Papst Gregor VII. stellte sich auf die Seite von Rudolf von Rheinfelden und damit gegen Heinrich IV.
- Heinrich IV. erklärte Papst Gregor VII. als abgesetzt und ernannte mit Clemens III. einen Gegenpapst.
|
| 1081 bis 1083 | - Heinrich IV. machte sich auf den Weg nach Italien, in der Hoffnung, den Investiturstreit mit Papst Gregor VII. beilegen zu können.
- Papst Gregor VII. exkommunizierte Heinrich IV. erneut.
- Heinrich IV. eroberte Rom und trat in erneute Verhandlungen mit Papst Gregor VII., die sich aber als schwierig gestalteten.
|
| 1084 | - Papst Gregor VII. hatte fast all seine Unterstützer verloren.
- Papst Gregor VII. wurde offiziell abgesetzt und durch Clemens III. ersetzt.
|
| ab 1085 | - 1085: Papst Gregor VII. starb.
- 1087: Die ehemaligen Unterstützer Gregors VII. wählten einen neuen Gegenpapst zu Clemens III.
- Der Streit zwischen dem Papsttum und Heinrich IV. ging weiter.
|
Der "Gang nach Canossa" stellte ein Schlüsselereignis des Investiturstreits dar. Wenn Du mehr darüber erfahren möchtest, dann wirf einen Blick in die gleichnamige Erklärung hier im Studyset!
Investiturstreit – Folgen
Der Investiturstreit hatte nicht nur gravierende Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Heinrich IV. und dem Papst, sondern erschütterte auch die Innenpolitik des Heiligen Römischen Reichs. Es entbrannten immer wieder Konflikte zwischen den Unterstützern Heinrichs IV. einerseits und denjenigen, die einen neuen König und ein Ende des Investiturstreits forderten, andererseits. Zu dieser Zeit kam es zu vielen kriegerischen Auseinandersetzungen innerhalb des Heiligen Römischen Reichs.
Schließlich wurde Heinrich IV. im Jahr 1105 sogar von seinem eigenen Sohn Heinrich V. abgesetzt. Doch auch unter dem neuen König ging der Investiturstreit weiter. Heinrich V. vertrat ebenfalls die Position, dass das Recht auf Investitur dem weltlichen Herrscher zustand, und so verstrickte auch er sich in den Konflikt mit dem Papsttum.
Zwei Einigungsversuche zwischen Heinrich V. und dem amtierenden Papst Paschalis II. wurden durch den Einfluss anderer hoher Geistlicher verhindert, da diese durch eine Einigung den Machtverlust der Kirche befürchteten.
Das Jahr 1111:
Heinrich V. hätte auf das Recht auf Investitur verzichtet, wenn die Kirche bzw. die Bischöfe im HRR auf sämtliche ihrer königlichen Regalien (weltlichen Zuwendungen) verzichtet hätten. Dazu zählten sämtliche Grafschaften und andere Ländereien, aber zum Beispiel auch bestimmte Rechte wie das Zehnt-Recht.
Dies hätte eine strikte Trennung zwischen weltlicher und geistlicher Macht bedeutete, da die Bischöfe ihren weltlichen Einfluss im HRR vollständig abgegeben hätten. Der Papst stimmte den Bedingungen vorerst zu. Doch nur kurze Zeit später widerrief Paschalis II. seine Übereinkunft mit Heinrich V. auf Drängen anderer Geistlicher hin, da diese ihre weltlichen Privilegien nicht abtreten wollten.
Und so zog sich der Investiturstreit noch weitere 11 Jahre hin, bis er 1122 schließlich doch beigelegt werden konnte – nämlich mit dem sogenannten "Wormser Konkordat".
Die Frage der Investitur in anderen europäischen Ländern
Vielleicht hast Du Dich schon gefragt, ob der Investiturstreit nur das Heilige Römische Reich betraf oder vielleicht doch auch die anderen europäischen Länder. Tatsächlich war die Laieninvestitur bis zur Verkündung des kirchlichen Anspruches auf die Investitur durch Gregor VII. auch in den anderen europäischen Königshäusern die Norm.
Und ebenso wie der römisch-deutsche König waren auch die anderen weltlichen Herrscher nicht erfreut über die Aussage Gregors VII., dass nun die Kirche das Recht auf Investitur beanspruchte. Doch anders als mit Heinrich IV. eskalierten die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Papst und den anderen weltlich Herrscher nicht in diesem Ausmaß.
In Frankreich, Spanien und England konnten die Streitigkeiten um die Investitur bis spätestens 1107 beigelegt werden. Im Heiligen Römischen Reich dauerte es noch weitaus länger, bis eine Einigung zwischen dem König und dem Papst getroffen werden konnte.
Investiturstreit – Wormser Konkordat
Das Wormser Konkordat wurde am 23. September 1122 zwischen dem römisch-deutschen König Heinrich V. und Papst Calixt II. geschlossen. Diese Übereinkunft beendete nach rund 47 Jahren den Investiturstreit im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.
Das Wormser Konkordat sah gewissermaßen eine "Teilung" der Investitur vor:
- Kirche: Der Kirche oblag nun die Wahl der Bischöfe und die geistliche "Einkleidung" mit Ring und Stab. Der römisch-deutsche König verzichtete vollkommen auf das Recht der geistlichen Investitur.
- Römisch-deutscher König/Kaiser: Der König/Kaiser konnte aber weiterhin seinen Wunschkandidaten für das Amt vorschlagen, durfte bei der Wahl anwesend sein und hatte im Falle eines Unentschiedens zischen mehreren Kandidaten die entscheidende Stimme. Zudem übergab der König/Kaiser die weltlichen Insignien, das Zepter und das Schwert, und wies die Geistlichen so in ihre weltlichen Rechte ein.
Investiturstreit – Ergebnis
Am Ende des Investiturstreits stand die Neuordnung der europäischen Machtverhältnisse. Bis Mitte des 11. Jahrhunderts standen die weltlichen Herrscher, also die Könige/Kaiser, eindeutig über der Kirche. Spätestens aber nachdem Heinrich IV. sich bei seinem Gang nach Canossa Papst Gregor VII. unterworfen hatte, war klar, dass sich diese umgedreht hatten.
Die Macht und der Einfluss der Kirche in Europa hatten stark zugenommen. Das römisch-deutsche Kaisertum hingegen war massiv geschwächt worden. Vor dem Investiturstreit hatten König/Kaiser und Kirche eine Einheit gebildet, die die "heilige" Stellung des Königs als Diener Gottes im Reich untermauerte. Nach dem Investiturstreit war diese Einheit nicht mehr vorhanden und das Amt des römisch-deutschen Königs/Kaisers hatte seinen geistlichen Charakter fast vollständig verloren.
Heinrich V. war übrigens der letzte römisch-deutsche Herrscher aus dem Geschlecht der Salier. Wenn Du wissen möchtest, wie es danach im Heiligen Römischen Reich weiterging, dann wirf gerne einen Blick in die Erklärung "Staufer" hier auf StudySmarter!
Investiturstreit - Das Wichtigste
- Investiturstreit – Definition: Als "Investiturstreit" bezeichnet man einen Streit von 1075 bis 1122 zwischen den salischen Königen/Kaisern des Heiligen Römischen Reichs und dem Papsttum.
- Investiturstreit – Ursache: Die Ursache für den Investiturstreit war, dass sowohl der römisch-deutsche König Heinrich IV. als auch Papst Gregor VII. das Investiturrecht für sich beanspruchten.
- Als "Investitur" (Einkleidung) wird die Einsetzung eines Geistlichen in ein kirchliches Amt (etwa Bischof) bezeichnet. Bevor Papst Gregor VII. das Investiturrecht 1073 für die katholische Kurie beanspruchte, hatte es stets der weltliche Herrscher wahrgenommen.
- Investiturstreit – Verlauf: Der Investiturstreit dauerte rund 47 Jahre und wurde zwischen verschiedenen römisch-deutschen Königen/Kaisern und Päpsten ausgetragen.
- Investiturstreit – Ergebnis: Der Investiturstreit wurde 1122 mit dem Wormser Konkordat zwischen Heinrich V. und Papst Calixt II. beigelegt. Die Kirche hatte erheblich an Macht gewonnen, während das römisch-deutsche Kaisertum geschwächt aus dem Konflikt hervorging.
Nachweise
- Johrendt, Jochen (2018). Der Investiturstreit. wbg Academic.
Wie stellen wir sicher, dass unser Content korrekt und vertrauenswürdig ist?
Bei StudySmarter haben wir eine Lernplattform geschaffen, die Millionen von Studierende unterstützt. Lerne die Menschen kennen, die hart daran arbeiten, Fakten basierten Content zu liefern und sicherzustellen, dass er überprüft wird.
Content-Erstellungsprozess:
Lily Hulatt ist Digital Content Specialist mit über drei Jahren Erfahrung in Content-Strategie und Curriculum-Design. Sie hat 2022 ihren Doktortitel in Englischer Literatur an der Durham University erhalten, dort auch im Fachbereich Englische Studien unterrichtet und an verschiedenen Veröffentlichungen mitgewirkt. Lily ist Expertin für Englische Literatur, Englische Sprache, Geschichte und Philosophie.
Lerne Lily
kennen
Inhaltliche Qualität geprüft von:
Gabriel Freitas ist AI Engineer mit solider Erfahrung in Softwareentwicklung, maschinellen Lernalgorithmen und generativer KI, einschließlich Anwendungen großer Sprachmodelle (LLMs). Er hat Elektrotechnik an der Universität von São Paulo studiert und macht aktuell seinen MSc in Computertechnik an der Universität von Campinas mit Schwerpunkt auf maschinellem Lernen. Gabriel hat einen starken Hintergrund in Software-Engineering und hat an Projekten zu Computer Vision, Embedded AI und LLM-Anwendungen gearbeitet.
Lerne Gabriel
kennen