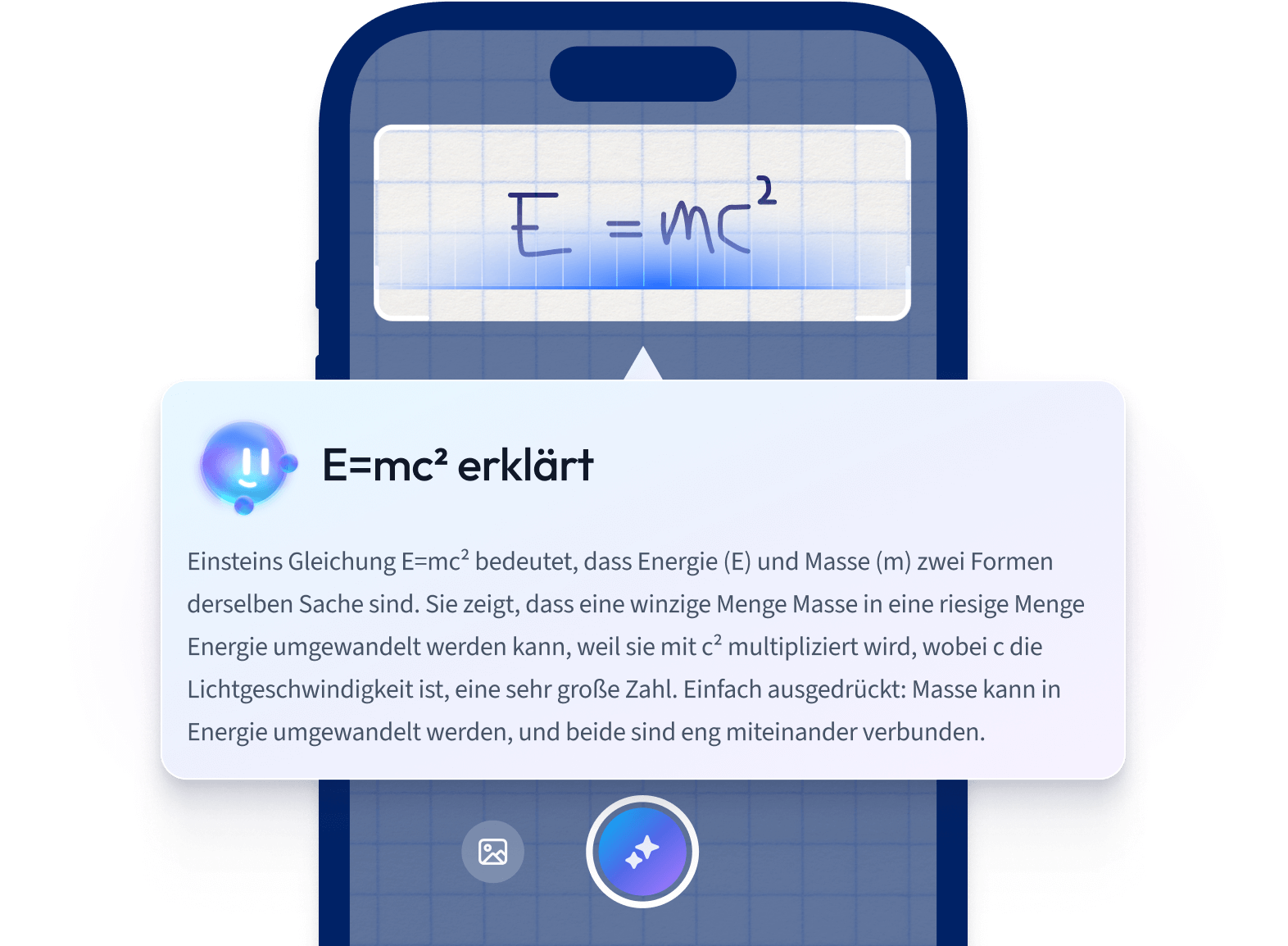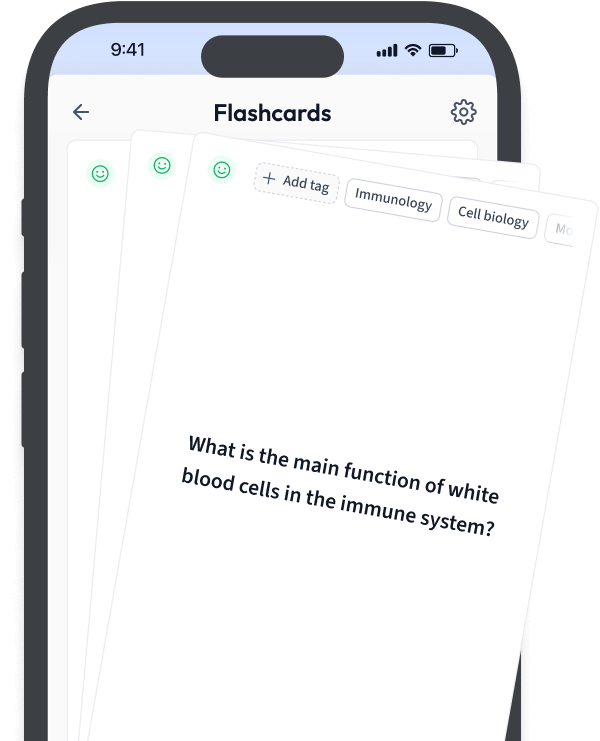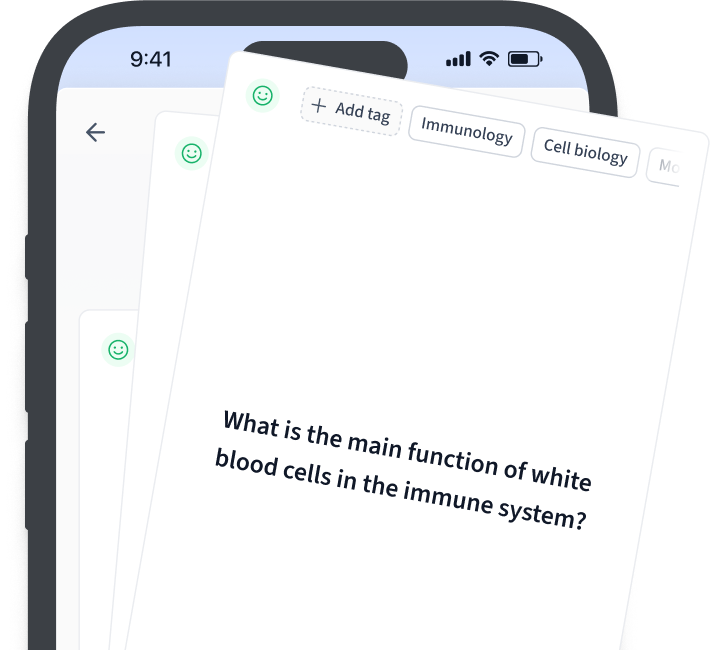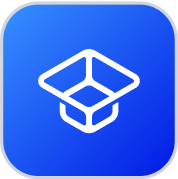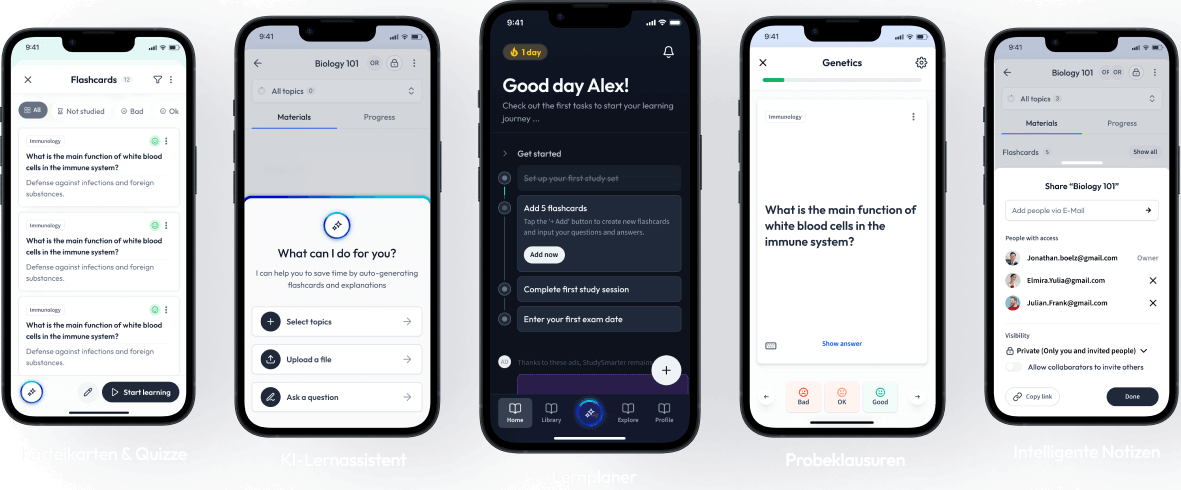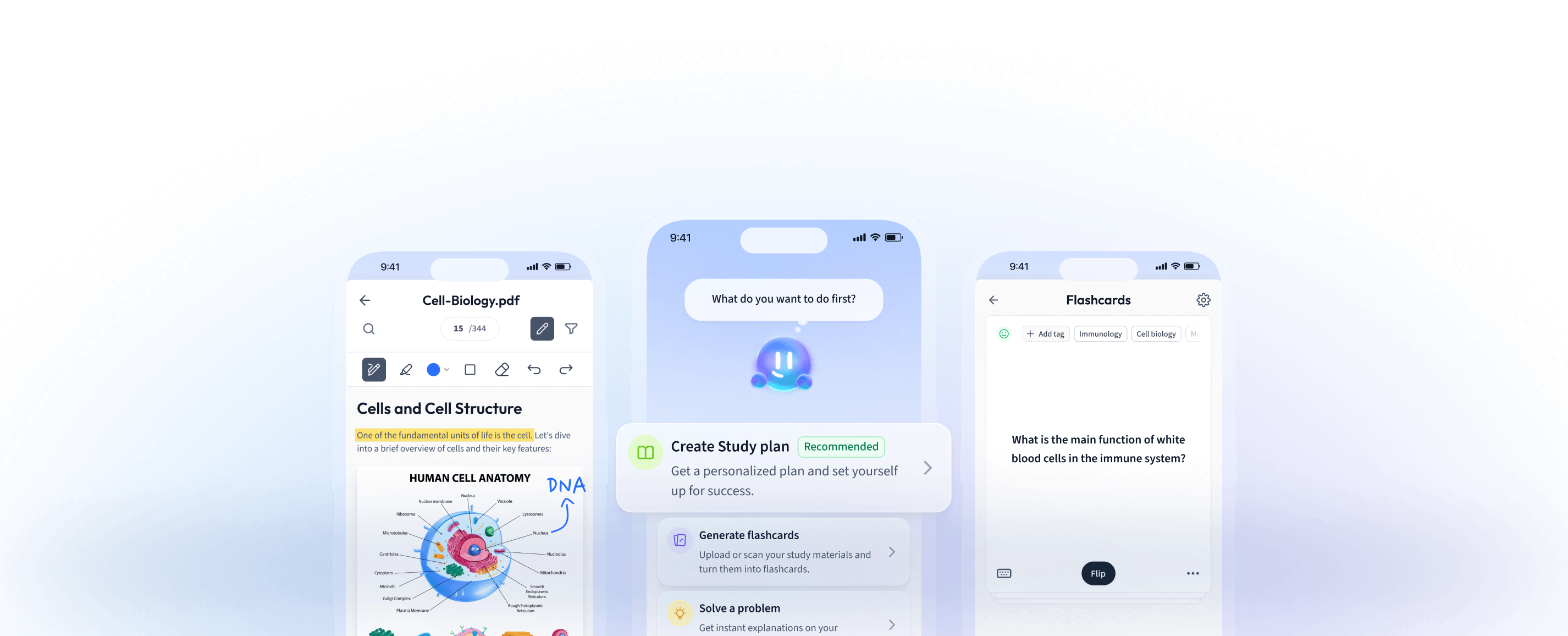Subsumtion Definition
Der Begriff Subsumtion setzt sich aus den beiden lateinischen Wörtern "sub" (dt. "unter") und "sumere" (dt. "nehmen") zusammen und bezeichnet einen Prozess, bei dem man einen Begriff oder einen Sachverhalt unter einen anderen Begriff einordnet.
Dabei ist diese Subsumtionstechnik insbesondere in den Rechtswissenschaften von enormer Bedeutung. So kann mithilfe der Subsumtion festgestellt werden, ob ein bestimmter Fall einer bestimmten Rechtsnorm zugeordnet werden kann.
Subsumtion Schema
Grundsätzlich besteht jede Subsumtion, unabhängig von ihrem Anwendungsgebiet, aus mindestens 3 Punkten:
- Obersatz
- Untersatz
- Schlussfolgerung
Im Obersatz wird zunächst eine abstrakte Aussage gemacht, während im Untersatz diese Aussage mit dem konkreten Fall verglichen wird. Im letzten Schritt erfolgt die sogenannte Conclusio, die man auch als Schlussfolgerung bezeichnen kann. Dies hört sich wahrscheinlich erst einmal kompliziert an, aber folgendes Beispiel kann Dir dabei helfen, die Subsumtionstechnik besser zu verstehen:
1. Obersatz: Jeder Schüler möchte gute Noten haben.
2. Untersatz: Marvin ist ein Schüler.
3. Schlussfolgerung: Marvin möchte auch gute Noten haben.
Subsumtion Jura
Die Subsumtionstechnik wird hauptsächlich bei juristischen Sachverhalten relevant. Dabei ist es unerlässlich, dass Du für die juristische Subsumtion ein paar Grundbegriffe kennst:
Wichtige Grundbegriffe
Bei der juristischen Subsumtion benötigst du zunächst eine Rechtsnorm.
Der Begriff Rechtsnorm bezeichnet Anordnungen, die hoheitlicher Natur und allgemein verbindlich sind. Diese Normen gelten für einen unbestimmten Personenkreis und sind entscheidend für die Rechtsordnung. Zu den Rechtsnormen zählen nicht nur Gesetze, sondern auch Satzungen und Rechtsverordnungen. Sie spielen eine zentrale Rolle im deutschen Recht, da sie den Tatbestand und die Rechtsfolge definieren und den Subsumtion Prozess steuern, was ihre Bedeutung für die Rechtsprechung unterstreicht.
Rechtsnormen besitzen in der Regel eine spezifische Struktur, die sich nach dem "Wenn-Dann"-Prinzip richtet. Der "Wenn"-Abschnitt wird von Juristen auch als Tatbestand bezeichnet, der "Dann"-Teil als Rechtsfolge. Dies ist natürlich sehr theoretisch, deswegen soll Dir folgendes Beispiel beim Verständnis helfen.
Du kommst gerade erschöpft aus der Schule und siehst auf dem Heimweg, wie der aggressive Bruno wieder einmal seinen kleinen Bruder Max verprügelt und ihm dabei ein blaues Auge verpasst. Hier kommt als Rechtsnorm zunächst einmal die Körperverletzung nach § 223 StGB in Betracht. In dieser Norm heißt es:
§ 223 (Körperverletzung)
(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
Der erste Abschnitt "Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt" ist der sogenannte Tatbestand. Der daran anschließende Teil ist hingegen die Rechtsfolge. Das heißt, dass wenn jemand einen anderen körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt (Tatbestand), er/sie eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe zu erwarten hat (Rechtsfolge).
Dementsprechend kannst du dir für die Begriffe des Tatbestands und der Rechtsfolge folgendes merken:
Der Tatbestand ist ein zentraler Bestandteil der Rechtsnorm Definition, da er die spezifischen Voraussetzungen festlegt, die erfüllt sein müssen, damit eine Rechtsnorm wirksam wird. Im Subsumtion Prozess wird geprüft, ob die gegebenen Tatsachen unter die definierten Merkmale der Tatbestand und Rechtsfolge fallen. Das Verständnis von Rechtsnormen und ihre Bedeutung ist entscheidend für die Anwendung im deutschen Recht, da es die Grundlage für rechtliche Entscheidungen bildet.
Dabei besteht der Tatbestand in der Regel aus mehreren Tatbestandsmerkmalen, die wiederum alle einzeln definiert werden müssen. Treffen alle einzelnen Definitionen der Tatbestandsmerkmale auf den jeweiligen Sachverhalt zu, dann ist der gesamte Tatbestand erfüllt und die jeweilige Rechtsfolge tritt ein.
Die Rechtsfolge einer Rechtsnorm bezieht sich auf die rechtlichen Konsequenzen, die eintreten, wenn der Tatbestand vollständig erfüllt ist. In der Subsumtion wird geprüft, ob die konkreten Umstände eines Falls unter die Voraussetzungen der Rechtsnorm fallen. Das Verständnis von Rechtsnormen und ihrer Bedeutung ist entscheidend für die Anwendung im deutschen Recht, da es die Grundlage für die rechtliche Bewertung von Handlungen bildet.
Demzufolge musst Du vor der eigentlichen juristischen Subsumtion folgende Schritte beachten:
- Zutreffende Rechtsnorm heraussuchen
- Tatbestand und Rechtsfolge innerhalb der Rechtsnorm erkennen
- Einzelne Tatbestandsmerkmale heraussuchen
Struktur einer juristischen Subsumtion
Sofern Du die drei Schritte erledigt hast, geht es an die Subsumtionstechnik. Wegen der Komplexität einiger Rechtsnormen wird die juristische Subsumtion abweichend von der allgemeinen Subsumtionstechnik folgendermaßen gegliedert:
| Abschnitt | |
| 1. Obersatz | Im Obersatz wird eine Hypothese aufgestellt. Dieser Obersatz wird im Konjunktiv gebildet. |
| 2. Definition | Anschließend wird das jeweilige Tatbestandsmerkmal abstrakt definiert. |
| 3. Untersatz (= Subsumtion) | Hier prüfst Du, ob der Sachverhalt unter die Definition eingeordnet werden kann und bildest ein Zwischenergebnis. |
| 4. Schlussfolgerung | In der Schlussfolgerung schreibst Du das Gesamtergebnis auf und beantwortest damit den von Dir zuvor gebildeten Obersatz. |
Das kannst Du natürlich Schritt für Schritt noch einmal am Beispiel vom prügelnden Bruno üben:
| Abschnitt | |
| 1. Obersatz | Bruno könnte sich wegen Körperverletzung gemäß § 223 StGB strafbar gemacht haben, indem er seinen Bruder Max verprügelte. |
| 2. Definition | § 223 StGB setzt entweder eine körperliche Misshandlung oder eine Gesundheitsschädigung voraus. Eine körperliche Misshandlung ist jedenfalls dann gegeben, wenn durch das Verhalten eine üble und unangemessene Behandlung vorliegt, die das körperliche Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeinträchtigt. |
| 3. Untersatz (= Subsumtion) | Durch Brunos Schläge wurde das körperliche Wohlbefinden von Max mehr als nur unerheblich beeinträchtigt. Damit liegt eine körperliche Misshandlung im Sinne von § 223 StGB vor. |
| 4. Schlussfolgerung | Bruno hat sich wegen Körperverletzung gemäß § 223 StGB strafbar gemacht, indem er seinen Bruder Max verprügelte. |
Somit hast Du einen konkreten Sachverhalt unter eine abstrakte Rechtsnorm zugeordnet. Diese Subsumtionstechnik wird auch als Gutachtenstil bezeichnet.
Falls du einmal ein juristisches Urteil lesen solltest, wundere dich bitte nicht, dass der Obersatz von dieser Struktur abweicht. Denn bei Urteilen wird mit dem Ergebnis (4. Schritt) begonnen. Alle anderen Punkte sind jedoch gleich. Diese Technik wird auch als Urteilsstil bezeichnet.
Subsumtion Beispiel
Nach so viel Theorie kannst Du das Gelernte natürlich noch ausführlich an einem Beispiel üben:
Du spielst mit Deinem besten Freund Michel das neue Rennspiel "Go Studies" und verlierst eine Runde nach der anderen gegen ihn. Das macht Dich so wütend, dass Du den Controller gegen den neuen Fernseher von Michel schmeißt. Dadurch zerspringt der Bildschirm und der Fernseher ist nicht mehr zu gebrauchen.
Bevor Du die Subsumtion anwendest, suchst Du Dir die entsprechende Rechtsnorm heraus. Dies ist im vorliegenden Fall § 303 StGB (Sachbeschädigung).
§ 303 StGB (Sachbeschädigung)
(1) Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert.
(3) Der Versuch ist strafbar.
In vorliegenden Fall kommt der 1. Abschnitt in Betracht. Der erste Teil ("Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört") ist der "Wenn"-Abschnitt und damit der Tatbestand. Der anschließende Teil ("mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft") ist der "Dann"-Abschnitt und folglich die Rechtsfolge.
Innerhalb des Tatbestands haben wir nun verschiedene Tatbestandsmerkmale. Dazu zählen die Merkmale "Sache", "fremd" und "beschädigen oder zerstören". Diese müssen in der Subsumtion alle einzeln definiert werden.
Da Du jetzt den Tatbestand und die einzelnen Tatbestandsmerkmale herausgefunden hast, geht es nun an das "Eingemachte":
| Abschnitt | |
| 1. Obersatz | Du könntest dich wegen Sachbeschädigung nach § 303 StGB strafbar gemacht haben, indem Du den Controller gegen den Fernseher von Michel geworfen hast. |
| 2. Definition des 1. Tatbestandsmerkmals "Sache" | Sachen sind nach § 90 BGB alle körperlichen Gegenstände. |
| 3. Untersatz (= Subsumtion) | Der Fernseher von Michel ist ein körperlicher Gegenstand |
| 4. Zwischenergebnis | Somit ist der Fernseher eine Sache im Sinne von § 90 BGB. |
| 5. Definition des 2. Tatbestandsmerkmals "fremd" | Der Fernseher müsste auch fremd für Dich gewesen sein. Dies ist dann der Fall, wenn die Sache zumindest auch im Eigentum einer anderen Person steht. |
| 6. Untersatz (= Subsumtion) | Der Fernseher gehörte Michel und stand somit in seinem Eigentum. |
| 7. Zwischenergebnis | Damit war der Fernseher auch fremd für Dich. |
| 8. Definition des 3. Tatbestandsmerkmals "Beschädigen" | Weiterhin müsstest Du den Fernseher beschädigt haben. Unter Beschädigen wird einerseits jede Substanzverletzung und andererseits bereits jede mehr als nur unerhebliche Reduzierung der Brauchbarkeit verstanden. |
| 9. Untersatz (= Subsumtion) | Du hast mit dem Wurf des Controllers gegen den Fernseher einen Riss im Bildschirm verursacht und damit eine Substanzverletzung begangen. Somit hast du den Fernseher auch beschädigt. |
| 10. Schlussfolgerung | Demnach hast du dich wegen Sachbeschädigung nach § 303 StGB strafbar gemacht, indem du den Controller gegen den Fernseher von Michel geworfen hast. |
Subsumtion - Das Wichtigste auf einen Blick
- Subsumtion = Technik zur Unterordnung von Begriffen
- Gliederung:
- Obersatz
- Untersatz
- Schlussfolgerung
- bedeutend in den Rechtswissenschaften
- bei der juristischen Subsumtion benötigst du zunächst eine Rechtsnorm
References
- Marco Oesting (2010). Simulationsverfahren fuer Brown-Resnick-Prozesse (Simulation Techniques for Brown-Resnick Processes). Available at: http://arxiv.org/abs/0911.4389v2 (Accessed: 28 January 2025).
- Andreas Arzt, Matthias Dorfer (2017). Aktuelle Entwicklungen in der Automatischen Musikverfolgung. Available at: http://arxiv.org/abs/1708.02100v1 (Accessed: 28 January 2025).
- Katharina Albrecht, Kristoffer Janis Schneider, Daniel Martini (2023). Öffentliche Daten auf die nächste Stufe heben -- Vom RESTful Webservice für Pflanzenschutzmittelregistrierungsdaten zur anwendungsunabhängigen Ontologie (erweiterte Version). Available at: http://arxiv.org/abs/2301.06877v1 (Accessed: 28 January 2025).
Wie stellen wir sicher, dass unser Content korrekt und vertrauenswürdig ist?
Bei StudySmarter haben wir eine Lernplattform geschaffen, die Millionen von Studierende unterstützt. Lerne die Menschen kennen, die hart daran arbeiten, Fakten basierten Content zu liefern und sicherzustellen, dass er überprüft wird.
Content-Erstellungsprozess:
Lily Hulatt ist Digital Content Specialist mit über drei Jahren Erfahrung in Content-Strategie und Curriculum-Design. Sie hat 2022 ihren Doktortitel in Englischer Literatur an der Durham University erhalten, dort auch im Fachbereich Englische Studien unterrichtet und an verschiedenen Veröffentlichungen mitgewirkt. Lily ist Expertin für Englische Literatur, Englische Sprache, Geschichte und Philosophie.
Lerne Lily
kennen
Inhaltliche Qualität geprüft von:
Gabriel Freitas ist AI Engineer mit solider Erfahrung in Softwareentwicklung, maschinellen Lernalgorithmen und generativer KI, einschließlich Anwendungen großer Sprachmodelle (LLMs). Er hat Elektrotechnik an der Universität von São Paulo studiert und macht aktuell seinen MSc in Computertechnik an der Universität von Campinas mit Schwerpunkt auf maschinellem Lernen. Gabriel hat einen starken Hintergrund in Software-Engineering und hat an Projekten zu Computer Vision, Embedded AI und LLM-Anwendungen gearbeitet.
Lerne Gabriel
kennen